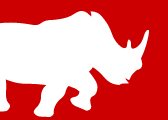
| Info zum Forum | Termine | Querbeet | Materialien | Presse | Links | Mailingliste | Kontakt | ||
| disKURSwechsel :: kultur | ||||||||||||||||
|
Calendar
Categories
Archives
XML/RSS Feed
|
||||||||||||||||
Die Griechen hatten keine Zeit für Kultur
Frank-Patrick Steckel über die Notwendigkeit, den Zusammenhang
von Theater und Gesellschaft zu rekonstruieren
14.11.2003
Im Gespräch
Die Griechen hatten keine Zeit für Kultur
REFORMBEDARF
Zum zehnten Jahrestag der Schließung der Staatlichen Schauspielbühnen Berlins am 3. Oktober 1993 fand auf der Bühne des Schiller- Theaters unter dem Titel Theaterland wird abgebrannteine Lagebestimmung des deutschen Theaters statt. Der Theaterinitiative des Bundespräsidenten, die am 14. November 2003 in Berlin ihre Fortsetzung finden soll, war nach Ansicht der Veranstalter eine Debatte vorauszuschicken, die das Theater weniger in seinen finanziellen Nöten, als in der grundsätzlichen, gesellschaftlich begründeten Krise seines Auftrags betrachten sollte.
Frank-Patrick Steckel, Jahrgang 1943, einer der bedeutenden Protagonisten des zeitgenössischen deutschen Sprechtheaters, gehörte zu den Initiatoren dieses Forums. 1970 war Steckel Gründungsmitglied der neuen Schaubühne am Halleschen Ufer unter Peter Stein. Von 1978 bis 1981 leitete er das Schauspiel des Bremer Theaters während der Intendanz von Arno Wüstenhöfer. 1986 wurde er zum Intendanten des Schauspielhauses Bochum berufen, das er - gemeinsam mit der Choreographin Reinhild Hoffmann und ihrer Compagnie - bis 1995 führte. Heute arbeitet Frank-Patrick Steckel als freier Regisseur.
FREITAG: Herr Steckel, die Schließung des Berliner Schiller-Theaters jährte sich Anfang Oktober zum zehnten Mal. Welche Bedeutung hat diese Schließung Ihrer Ansicht nach für die heutige kulturelle Situation?
FRANK-PATRICK STECKEL: Eine entscheidende. Sie war das Signal zur letzten Jagd. Die reichen Deutschen schließen das Staatstheater ihrer alten und neuen Hauptstadt, also was wollt ihr? Noch die Kollegen aus Petersburg bekamen das zu hören, wenn sie daheim nach der Zukunft ihrer Theater fragten.
Das Problem in Berlin bestand darin, dass die Schließung ein Vorgang war, der über zehn, fünfzehn Jahre hinweg vorbereitet wurde, und zwar von den Politikern wie den Theaterleuten gleichermaßen. Die Politiker trafen die falschen künstlerischen Personalentscheidungen und die Künstler beeilten sich, oft in grotesker Fehleinschätzung ihrer Kräfte, das unter Beweis zu stellen. Das Ganze ist eine Katastrophe in vielfacher Hinsicht. Einmal, weil eine große traditionelle Sprechbühne, an der bedeutende Aufführungen stattgefunden hatten, verschwand und damit das Lebenswerk von Boleslaw Barlog und einer oder zwei Generationen wesentlicher Schauspieler und Regisseure und jede Möglichkeit einer Reform liquidiert wurden. Zum anderen wegen der sich offenbarenden Hilflosigkeit, mit der die Theaterleute dem Untergang schwatzend beiwohnten, sofern sie nicht - und das war in Berlin leider überwiegend der Fall - in schrecklicher Kurzsichtigkeit meinten, sich klammheimlich freuen zu dürfen. Und zum dritten wegen der nunmehr erwiesenen politischen Jagdbarkeit selbst großer Theater. War das Schiller Theater schließbar, war jedes Theater schließbar. In diesem Klima leben und arbeiten wir heute.
Würden Sie sagen, der damalige Vorfall hat die Fronten geklärt, an denen heute die Schlacht der Kulturpolitik geschlagen wird?
Nein. Das, worüber wir jetzt geredet haben, ist nur die äußere Hülle des Problems. Das Problem hat andere Seiten, die sich mit Fragen berühren, die man an die ganze Gesellschaft stellen muss. Wohin soll sich das Ganze eigentlich bewegen? Es wird uns gesagt, dass es zum ökonomischen Prinzip der Raffgier keine Alternativen gäbe. Das kann man Theaterleuten aber nicht erzählen. Theaterleute denken professionell in Alternativen. Außerdem ist Raffgier nichts besonders Schönes. Das ist ein Punkt in der Diskussion mit den Politikern, der sich rasant dem Aufprall auf etwas Hartes, innerhalb wie außerhalb der Theater, nähert. Die Wahlbeteiligung in Brandenburg von 46 Prozent spricht für sich. Die Frage, wohin die gesamtgesellschaftliche Entwicklung gehen soll, bildet die Grundlage jeder Debatte darüber, ob ein Theater geschlossen wird. Theaterarbeit geht generell nicht mit der Agenda 2010 konform, sie kann es gar nicht. Ein Problem des Theaters ist, dass es mehr und mehr von solchen Fragestellungen abgekoppelt wurde.
Hat die Politik diese Abkopplung zu verantworten?
Ja auch, aber auch von Seiten der Künstler ließ das Interesse an gesellschaftlichen Fragen ständig nach, während die Situation der Theaterleute der Deutschen Demokratischen Republik sich mit der Wende krass wandelte und sie quasi zwangsentpolitisiert wurden. Ich kann mich nicht erinnern, dass westdeutsche Theaterleute in irgendeiner erkennbaren Form in den Prozess der Wiedervereinigung auch nur hineingeredet hätten, geschweige denn hineingewirkt. Während die Theaterleute der DDR gezwungen wurden zu akzeptieren, dass von ihrer Arbeit und ihrem Land so gut wie nichts übrig bleiben würde.
Dem Theater fehlen die Fürsprecher außerhalb der eigenen Reihen. Es fehlen damit auch Leute, die sich öffentlich für die Notwendigkeit dieser Staatsausgabe stark machen wollen.
Wenn das Bürgertum seine Repräsentanzinstitute, Museen, Orchester, Theater, Ballettcompagnien aufgibt, zunächst innerlich aufgibt, dann ökonomisch, aus Gründen, über die zu reden wäre, dann gibt es keinen Ersatz. Es steht jenseits des Bürgertums keine andere Klientel für das Theater zur Verfügung. Die Frage, warum das Bürgertum diese Institutionen aufgibt, kann man mit der ganz allgemeinen Frage verbinden, welches Bild es von sich selbst haben will und was der Mensch in der spätbürgerlichen Kapitalgesellschaft von heute gilt. Warum soll man die Angelegenheiten des Menschen in einer Gesellschaft, in der der Mensch im Allgemeinen nichts als Geringschätzung erfährt, auf der Bühne verhandeln? Das Reden von Niedriglohnempfängern, das Reden von Arbeitsunwilligen, von Verbrauchern, das Reden von Ich-AGs und Minijobs entstammt dem Wörterbuch der sozialen Geringschätzung. In Form eines antikulturellen, deformierenden Erosionsprozesses durchdringt diese Geringschätzung alle sozialen Sphären, entsolidarisiert sie, und die unmittelbar Betroffenen lernen, sich selbst zu verachten. Für das Theater ist das tödlich.
Was haben diese Menschen mit dem Theater zu tun? Sie gehen überwiegend nicht hin, schon, weil sie es sich gar nicht leisten können.
Die Frage ist nicht, was haben diese Menschen mit dem Theater zu tun, sondern, was hat das Theater mit ihnen zu tun. Wenn ein Arbeitsloser nicht ins Theater geht, weil er sich davon nichts verspricht, ist das Theater deshalb nicht berechtigt, ihn zu vergessen, im Gegenteil.
Das Bürgertum versagt hier nicht nur als Publikum, sondern vor allem als Funktionselite in der Gesellschaft. Es hält es nicht mehr für nötig, eine Art von sozialer Gesamtverantwortung zu übernehmen. Auf diese Weise entsteht eine kulturelle Agonie, der sich auch die Theater nicht entziehen können. Diese Agonie führt auch innerhalb der Theater zur Erosion, zur Schließbarkeit. Derjenige, der sich gegen Schließungen wehrt, muss sich gleichzeitig für eine Rekonstruktion des Zusammenhanges von Theater und Gesellschaft und gegen die Asozialität oder soziale Gleichgültigkeit weiter Teile seines Publikums aussprechen.
In welchen Bereichen besteht aus Ihrer Sicht Reformbedarf der Theaterarbeit? Geht es da wirklich vor allem um die Tarife von Bühnenarbeitern, wie man auf vielen kulturpolitischen Diskussionsforen zu hören bekommt?
Der Reformbedarf hat viele Gesichter. Eines davon ist das finanzielle. Von Reformen wird gern im Hinblick auf Einsparungen geredet. Das ist eigentlich Unsinn. Ein Theater, das auf sich hält, braucht gute Kostümwerkstätten, eine gute Maske, eine gute Schuhmacherei, eine gute Putzmacherei, eine gute Requisite, eine gute Beleuchtung, eine gute Technik, lauter qualifiziert arbeitende Abteilungen, wenn es seinen Gestaltungsmöglichkeiten in der gebotenen Vielfalt nachkommen will. Ein stehendes Theater, das sich ernst nimmt, sollte sehr unterschiedliche ästhetische Strategien verfolgen und ist folglich personalintensiv und kostspielig.
Worin besteht denn dann der Reformbedarf?
Das viel Dringendere wäre eben eine politische, eine kulturpolitische Reform, eine Funktionsbestimmung dieser Häuser, die in ihnen selbst vorgenommen wird, gestützt von einer Kulturpolitik, die wieder willens ist, sich vorzustellen, dass es so etwas wie Opposition gegen das, was wir hier haben, in diesen Theatern geben könnte und dass Kunst, will sie Kunst sein, sich mit dem Bestehenden nicht abfinden kann und darf. Das ist der eigentliche Reformgedanke.
Für diesen Reformgedanken darf man in der Kulturpolitik wohl kaum Unterstützung erwarten.
Warum eigentlich nicht? Früher gab es Kulturpolitiker, die wussten, dass Kunst Opposition sein muss. Leute wie Glaser in Nürnberg beispielsweise oder Hoffmann in Frankfurt am Main oder Erny in Bochum, die suchten ihre Leute so aus. Heute ist genau das Gegenteil der Fall. Die dritte Reformfrage ist die der inneren Struktur. Es berührt mich bitter, wenn ich sehe, wie wenig Erinnerung an die Schaubühne zurückgeblieben ist. Das war der Versuch eine demokratische, faire Struktur herzustellen, in der keine Macht ausgeübt werden konnte, die sich nicht zu legitimieren bereit war. Die Macht, die Peter Stein an der Schaubühne ausübte, verdankte sich seiner intellektuellen Kapazität und seiner handwerklichen Autorität. Heute finde ich immer mehr undurchschaubare Machtverhältnisse vor. Die vielfachen Depressionen und Lähmungserscheinungen entspringen häufig der vom Ensemble nicht hinterfragbaren Inkompetenz seiner Vorstände, nicht zuletzt deren menschlicher Inkompetenz. Sie vergiftet die Atmosphäre in den Häusern.
Sind denn diese demokratischen Theaterstrukturen als Normalfall eines Stadttheaters überhaupt umsetzbar? So etwas bedeutet doch eine enorme Verausgabung jedes Einzelnen in der geteilten Verantwortung für das Ganze.
Dem muss man sich stellen. Es geht nicht, dass ein fest engagierter Schauspieler seine Arbeit lediglich darin ausgedrückt sieht, dass er alle sechs Wochen ein anderes Kostüm anzieht. Daran hängen viele andere Fragen. Wäre es nicht besser, längere Probenzeiten und weniger Premieren anzusetzen, dafür aber eine höhere Aufführungsqualität zu erreichen? Die Theaterarbeit als solche zu intensivieren und den quasi industriellen Ablieferbetrieb zu drosseln? Und dann muss fair und human vermittelt werden zwischen den zwei heterogenen sozialen und körperlichen Wirklichkeiten des Theaters, der Wirklichkeit des Schauspielers, der die Phantasie, und der des Technikers, der die Klamotten bewegt. Es gibt Techniker, die sind seit 30 Jahren an einem Haus und haben noch nie eine Vorstellung gesehen. Es muss also am Theater etwas gesellschaftlich und persönlich vermittelt werden, was sonst nirgendwo vermittelt werden muss, dessen Vermittlung öffentlich geradezu gemieden und unterdrückt wird. Da helfen Tarifzankereien wenig.
Ich möchte noch einmal auf die gesellschaftliche Funktion von Theater heute zu sprechen kommen. Was geht verloren, wenn in der "Provinz" Theater geschlossen werden, wo es keinen Ersatz für diese spezielle Form der Auseinandersetzung gibt?
Das Desaster ist eingebettet in ein anderes, größeres, das der amerikanische Soziologe Richard Sennett den Tod des öffentlichen Lebens nennt. Es ist nicht in erster Linie das Konkurrenzverhältnis zwischen Fernsehen und Theater, an dem das Theater leidet. Das Fernsehen täuscht vor, man könne am öffentlichen Leben teilnehmen, ohne sich in die Gesellschaft hinein begeben zu müssen. Das ist sein wesentlicher Beitrag zum Erlöschen des öffentlichen Lebens. Dieser Verödungsprozess muss im Gang sein, damit ein Theater geschlossen werden kann, und wird das Theater geschlossen, dann beschleunigt er sich. Das andere mit dem Nachrichtengewerbe verbundene Problem ist sein nichtswürdiges Menschenbild, zum Beispiel in der kommerziellen Werbung.
Aus der Sicht des Marktes ist im Verhältnis zur Nachfrage unser bundesdeutsches Theaterangebot noch allzu reichhaltig. Hier kann noch gespart werden. Was halten Sie dem entgegen? Warum brauchen wir das Theater?
In dem Augenblick, in dem man diese Frage stellt, brauchen wir das Theater nicht mehr. Heidegger sagt irgendwo, die Griechen hatten keine Zeit für Kultur. Und damit ist gemeint, sie hatten keine Zeit für Kultur nötig, weil sie Kultur hatten. Aber gibt es erst einen Kultursenator und eine Kultursendung und einen Kulturbeauftragten und ein Kulturprogramm und eine Kulturfinanzierung, dann gibt es keine Kultur im eigentlichen Sinn des Begriffs mehr. Und dann muss man die Frage "Warum braucht man ein Theater" stellen und dann ist auch klar, dass man kein Theater mehr braucht.
Wie und wann denken Sie an Ihr Publikum?
Jede Sekunde. Wenn ein Schauspieler sich in einem Raum bewegt und wir nach einem Ausdruck suchen, dann bin ich der Repräsentant der hoffentlich fünfhundert Leute, die hier später sitzen werden, um sich die Aufführung anzusehen. Ich möchte ein klares, humanes, bewusstes und geistvolles Verhältnis zwischen Schauspieler und Zuschauer etablieren. Dazu gehört, dass Schauspieler und Zuschauer die Bühne als einen besonderen Ort akzeptieren, einen Ort, der ihren Respekt verdient, weil er etwas Ungewöhnliches für sie leistet.
Schaufelt das Theater sich sein eigenes Grab, wenn es die Schwelle zur Bühne nicht hoch genug ansetzt, um mit Künstlichkeit Distanz zur Gegenwart, zum Alltäglichen zu schaffen?
Mit Sicherheit. Die grassierende Beschränkung der Theatermittel auf die vertrauten Ästhetiken der Gegenwart, stellt in meinen Augen eine bedauerliche Verengung des Spielraums dar, das ist wie Malen ohne Farben. Ich möchte etwas ganz anderes. Ich möchte mit falschen Haaren und künstlichen Nasen und mit seltsamen Kostümen herum spielen. Theaterformen anderer Kulturkreise würden sich dieses Ausbluten sowieso nicht gefallen lassen. Wir haben keine prächtigen Konventionen mehr, die sind uns alle zerbrochen worden. Das hohle Pathos und das falsche Pathos haben das Pathos generell missbraucht und verschluckt. Was Peter Rühmkorf schon 1962 als Attacke gegen Paul Celan zu Papier gebracht hat "Schluss mit dem Pathos, es lebe die Ironie", liest man heute erschrocken wie ein Manifest für die Dinge, die heute auf dem Theater gang und gäbe sind. Das entzieht jeder ernsthaften Beschäftigung mit Theater und dem, was ein Schauspieler ist, die Grundlage. Die Kategorie des Spiels, des Spielens verblasst.
Was können die Theaterleute tun, um den Zusammenhang zwischen der Gesellschaft und ihrer Arbeit wieder deutlich werden zu lassen?
Die Theater sollten sich weigern, auch nur eine müde Mark einzusparen. Die Intendanten sollten die Politik darauf hinweisen, dass die Verarmung der öffentlichen Hand von ihr selbst zu verantworten ist und dass sie nicht einsehen, warum man dieser falschen Politik durch absurde Kürzungen Vorschub leisten soll, deren prozentualer Anteil an der Bewältigung der finanziellen Gesamtkrise aufgrund des geringen Haushaltsanteils sowieso marginal ist. Mit einem Anteil von 0,2 Prozent kann man nicht 99,8 Prozent sanieren. Die Theaterkünstler sollten den Spieß umdrehen und anfangen von gesamtgesellschaftlichen Tatbeständen zu reden, die sie betreffen, aber eben auch viele andere, die Rentner, die Kranken, die Arbeitslosen, die sozial Schwachen. Darüber muss so lange und so deutlich geredet werden, bis ins Bewusstsein der Öffentlichkeit gedrungen ist, dass der Angriff auf die Theater ein Angriff auf sie selber ist, auch auf die Menschen, die nicht ins Theater gehen. Rentenkürzungen, Erhöhungen von Versicherungsbeiträgen, Angriffe auf die privaten Rücklagen, die doch andererseits gerade verlangt werden, Verlängerung der Lebensarbeitszeit, obwohl du mit 40 schon keinen Arbeitsplatz mehr kriegst, dieser ganze aggressive Irrsinn bedroht ja uns alle. Und diesen Zusammenhang ebenso aggressiv herzustellen, ist das Allerwichtigste in der nächsten Zeit. Da ist Frankreich einmal mehr ein gutes Beispiel.
Das Gespräch führte Anna Opel
Text im PDF-Format:
frank2.pdf
Posted: Fr - November 21, 2003 at 05:45 nachm.
>