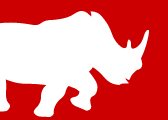
| Info zum Forum | Termine | Querbeet | Materialien | Presse | Links | Mailingliste | Kontakt | ||
| disKURSwechsel :: Agenda 2010 | ||||||||||||||||
|
Calendar
Categories
Archives
XML/RSS Feed
|
||||||||||||||||
Reformspiel über Bande
Zum Wechsel des SPD-Parteivorsitzes
von Daniel Kreutz
Betrachtet man die öffentliche Diskussion über den
Rückzug des Bundeskanzlers vom Parteivorsitz der SPD zu Gunsten von
Fraktionschef Franz Müntefering, so überwiegen Deutungen, wonach dies
als „Schwächung des Reformkurses“ im Wege der Stärkung des
Einflusses der Partei auf die Regierungspolitik in Richtung von „mehr
sozialer Gerechtigkeit“ oder weniger sozialer Grausamkeit zu verstehen
sei. Die harsche Reaktion Wolfgang Clements, des Motors der neoliberal
inspirierten post-sozialdemokratischen Reformpolitik, scheint diese Wahrnehmung
zu stützen. Infolge dessen hat die SPD in Umfragen bereits unmittelbar nach
Beginn dieser Diskussion zugelegt. Deutungen dieser Art gehen jedoch
fehl.
Reformspiel über Bande
Zum Wechsel des
SPD-Parteivorsitzes
von Daniel Kreutz
Betrachtet man die öffentliche Diskussion über den
Rückzug des Bundeskanzlers vom Parteivorsitz der SPD zu Gunsten von
Fraktionschef Franz Müntefering, so überwiegen Deutungen, wonach dies
als „Schwächung des Reformkurses“ im Wege der Stärkung des
Einflusses der Partei auf die Regierungspolitik in Richtung von „mehr
sozialer Gerechtigkeit“ oder weniger sozialer Grausamkeit zu verstehen
sei. Die harsche Reaktion Wolfgang Clements, des Motors der neoliberal
inspirierten post-sozialdemokratischen Reformpolitik, scheint diese Wahrnehmung
zu stützen. Infolge dessen hat die SPD in Umfragen bereits unmittelbar nach
Beginn dieser Diskussion zugelegt. Deutungen dieser Art gehen jedoch fehl.
Vor dem Hintergrund meiner persönlichen Erfahrung mit den Mechanismen
„professioneller“ Politik und immerhin zwei der Akteure
(Müntefering und Clement) ist gerade das, was als
„Unsicherheit“ für die Zukunft der Agenda-Reformen erscheinen
mag, tatsächlich als Versuch konzipiert, ihr gegen den Trend zunehmender
Abwendung erheblicher Teile der sozialdemokratischen Wählerschaft wieder
Stabilität zu verleihen. Und dieser Versuch jst gleichermaßen bitter
nötig wie aussichtsreich.
Es ist mittlerweile offensichtlich, dass die rücksichtslose
Durchsetzung von Reformen, die die traditionellen sozialdemokratischen Werte der
sozialen Gerechtigkeit, der Solidarpflicht der Starken gegenüber den
Schwachen mit Füßen treten und dahin tendieren, die sozialpolitischen
Errungenschaften der Sozialdemokratie im 20. Jahrhundert auszulöschen, zu
Mitgliederverlusten führt, deren qualitative Dimension ihre quantitative
weit übersteigt. Noch stärker und noch bedrohlicher wirkt die stetige
Erosion der SPD-Wählerschaft, die seit dem Rückzug Oskar Lafontaines
zur Dauererscheinung würde.
Auch Clement weiß, dass er nur dann „dran“ bleibt und die
Chance hat, sein Politikkonzept durchzusetzen, wenn die SPD in der Lage ist, die
Bundestagswahl 2006 für sich zu entscheiden. Da sein offener Radikalkurs so
in der SPD nicht mehrheitsfähig ist, ist er darauf angewiesen, dass andere
- mit unvermeidlichen Konzessionen an das Gerechtigkeitsempfinden - den Laden
zusammen halten und die Wählerschaft entsprechend beeinflussen können.
Diese Konzessionen dürfen allerdings nicht so weit gehen, dass die
Fortsetzung des „Reformkurses“ in Frage stünde. Sie müssen
sie sich im Symbolischen erschöpfen.
All dies dürfte Schröder genauso sehen. Der verbliebene
„Sozialflügel“ der SPD bietet gute Voraussetzungen dafür,
dass eine Strategie der symbolischen Befriedung des beunruhigten
sozialdemokratischen Gewissens ausreicht, um mit weit geringeren
Widerständen auf dem Weg der Agenda 2010 voranzugehen. Ein im
innerparteilichen Machtgefüge bedeutsamer Faktor sind
„Sozialflügel“ und Parteilinke längst nicht mehr. SPD
Parteitage haben - mehr noch als die der Grünen - die
Führungsanträge zur Unterstützung des „Reformkurses“
stets mit erdrückenden Mehrheiten und ohne ernstzunehmende Herausforderung
durch politische und personelle Alternativen verabschiedet. Wo sich Kritik am
Kurs offen artikuliert, beschränkt sie sich unter sorgsamer Umgehung der
Richtungsfragen auf nachsorgende Schadensbegrenzungen im Detail. Es ist ein
plausibles Kalkül, dass man eine solche Partei verstärkt hinter dem
Agenda-Kurs einigen kann, wenn man der „sozialdemokratischen Seele“
mit Symbolen schmeichelt.
Ein solches Symbol ist Franz Müntefering selbst. Seine frühere
Konfliktfähigkeit mit Clement in NRW verleiht ihm die Aura, für
„ was anderes“ zu stehen als Clement. Die beeindruckt auch dann
noch, wenn „Münte“ nicht müde wird, auf die Fortsetzung
des Agenda-Kurses zu drängen. Wenn der erklärt, dass man „Tempo
rausnehmen“ müsse, mag dies eine Verlangsamung des Tempos andeuten.
Mit einem Richtungswechsel hat eine solche Aussage schon sprachlich nichts zu
tun. Zugleich wird bekräftigt, dass an den bereits weit im Verfahren
befindlichen Rentenreformen nicht gerüttelt werde. Dann wird schon eher die
Pflegereform aufgeschoben. Erst wenn die Rücklagen der Pflegeversicherung
vollends zur Neige gehen, entsteht schließlich jene
„Sachzwang“-Suggestion, die zur Gewinnung öffentlicher
Akzeptanz für soziale Grausamkeiten unerlässlich ist.
Mit den neuerlichen Schlägen gegen die Rente und der beabsichtigten
Konterreform der Pflegeversicherung ist aber die Reform-Agenda im Sozialbereich
ohnehin erschöpft. Dass unter diesen Umständen versprochen wird,
„Tempo raus zu nehmen“, so lange nicht beschädigt wird, was in
der Pipeline ist, kostet nicht viel und entspricht weitgehend dem ohnehin zu
erwartenden Verlauf auf das Wahljahr 2006 zu.
Gerade Clements Reaktionen auf den Vorsitzenden Müntefering verhelfen
dem zur notwendigen sozialen Glaubwürdigkeit: wenn Clement seine Politik
wegen Müntefering gefährdet sieht, muss der doch deutlich sozialer
sein. Das Spiel geht ähnlich wie in der Tarifpolitik, wo öffentliche
Krokodilstränen des Arbeitgeberverbands der beste Beitrag dazu sind, der
gewerkschaftlichen Tarifkommission einen miserablen Abschluss als Erfolg zu
verkaufen.
Das SPD Landeschefs, die Kommunal- und Landtagswahlen entgegengehen, links
für soziale Gerechtigkeit blinken, wie derzeit Harald Schartau mit
Nachbesserungsforderungen zur Belastung der Betriebsrenten mit doppelten
Krankenkassenbeiträgen, sollte seit des Reformers“ Sigmar Gabriels
„Kampf“ für die Vermögensteuer keinerlei Neuigkeitswert
haben. Neben personellen sind schließlich auch fachpolitische Symbole
gefragt, will man den Laden zusammenhalten.
Ein solches Symbol ist – zumindest vorerst - auch die Debatte um die
Ausbildungsabgabe. Es ist bemerkenswert, in welchem Maße die Medien
geneigt sind, die aktuelle Diskussion als Indiz einer drohenden
„Kurskorrektur“ zu werten. Immerhin war die Abgabe in Schröders
Agenda-Erklärung vom März 2003 schon ausdrücklich erwähnt
– als „Drohpotential“ gegenüber der Wirtschaft für
den Fall, dass sie es an hinreichend darstellbaren Anstrengungen
gegenüber der Ausbildungslosigkeit vermissen lässt. Solange das
entsprechende Gesetz nicht beschlossen ist, bleibt das Thema auf der Ebene des
„Säbelrasselns“. Und Müntefering wählte mit Bedacht
die Sprachregelung, dass über die Abgabe – wie über die
Erbschaftssteuer – „gesprochen“ werden müsse.
Die rot-grüne Landesregierung in NRW hat in der 2. Hälfte der
90er Jahre mit der Drohung der Ausbildungsabgabe die Wirtschaft in den
Ausbildungskonsens NRW mit den Gewerkschaften genötigt. Damit hat
sie andererseits den DGB-NRW dazu gebracht, die gewerkschaftliche Forderung nach
der Abgabe so tief zu hängen, dass die Arbeitgeber-Partner im
Konsensbündnis nicht vergrätzt wurden. Zwar blieb die erforderliche
Verbesserung der Lage am Ausbildungsstellenmarkt aus, doch galt vorerst, was
Walter Riester als designierter Arbeits- und Sozialminister vor der
Bundestagswahl 1998 in einem Zeitungsinterview sinngemäß sagte:
Entscheidend sind nicht die Zahlen. Entscheidend ist, dass den Menschen das
Gefühl zu geben, dass dran gearbeitet wird.
Warum sollte die SPD-Spitze nicht den Versuch machen, diese schon einmal
erfolgreiche Strategie auf Bundesbene zu wiederholen? Solange das
„Drohpotenzial“ der Abgabe gebraucht wird, um die Wirtschaft zu
Zugeständnissen zu bringen, die ausreichen, um den Verzicht auf die Abgabe
plausibel zu machen, ist es auch hervorragend geeignet, der
„sozialdemokratischen Seele“ zur Illusion einer politischen
Konfrontation mit dem Arbeitgeberlager zu verhelfen.
Wenn über die Erbschaftssteuer oder selbst die
Vermögensteuer „gesprochen“ wird, ist dies schon
angesichts der Blockademauer des Bundesrats auch nicht mehr als
„symbolisch“. Kein Millionenerbe und kein Großvermögender
muss sich deshalb ernsthaft sorgen.
Bei der Rente scheint sich der „Sozialflügel“
gegenwärtig auf die Verteidigung einer Niveausicherungsklausel zu
konzentrieren. Die verpflichtet den Gesetzgeber zur Intervention, wenn das
Rentenniveau ansonsten unter einen bestimmten Wert absinkt. Auch dies wäre
ein bloßes Symbol, denn gerade die aktuelle Rentenreform zeigt, dass eine
solche Sicherungsklausel mit entsprechenden gesetzgeberischen Mehrheiten ebenso
schnell wieder abgeschafft wie eingeführt werden kann. Substanziell
wäre etwa ein Nein zum „Nachhaltigkeitsfaktor“, der die Renten
langfristig derart kürzt, dass der Ruf nach der Niveausicherungsklausel
erst Plausibilität gewinnt. Aber das wäre eine Richtungsfrage.
Auch in der Mitte der letzten Legislaturperiode befand sich die SPD im
Stimmungstief. War es nicht schon damals Müntefering, der im Vorwahlkampf
aus ungünstiger Ausgangslage darauf hinwies, dass das Spiel erst mit dem
Abpfiff vorbei ist? Die Voraussetzungen, die Aufholjagd erneut aus der Defensive
heraus zu gewinnen, sind weniger schlecht als allgemein vermutet. Das Thema
„Bürgerversicherung contra Kopfpauschalen“ ist hervorragend
für die Inszenierung eines Lagerwahlkampfs auf dem Feld der
Gesundheitspolitik geeignet – erst recht, nachdem hier in Folge der
jüngsten Reform in der Bevölkerung alle Nerven blank liegen. Dass es
beiden „Lagern“ letztlich darum geht, die Arbeitgeber weiter aus
ihrer Finanzverantwortung für die Krankenversicherung zu entlassen, kann
leicht überdeckt werden. Ein ähnliches, im SPD-Kernmilieu eher noch
zugkräftigeres Symbolthema ist die „Verteidigung des
Flächentarifvertrags“ gegen die Absicht der Opposition, per Gesetz
betriebliche Abweichungen vom Tarifvertrag zu ermöglichen. Die Arbeitgeber
können gut damit leben, dass unter dem Druck der gleichen Kanzlerdrohung
auf gewerkschaftlicher Seite die Bereitschaft gewachsen ist, entsprechende
Deregulierungen des Tarifvertrags per Tarifvertrag zu bewerkstelligen.
Gleichwohl ließe sich bereits auf diesen beiden Schienen ein Wahlkampf mit
der Suggestion „sozial gegen unsozial“ inszenieren. Die
Glaubwürdigkeit einer solchen Unternehmung hängt davon ab, dass der
SPD entgegen ihrer eigenen Regierungspolitik wieder abgekauft wird,
„für das Soziale“ zu stehen. Denn nur dann wird sich das
benötigte Heer der ehrenemtlichen Helfer, die aus Überzeugung -
vielleicht weniger für ihre Partei als „gegen die Rechten“
– für den Wahlerfolg der SPD trommeln, in Bewegung setzen lassen.
Dafür soll „der Franz“ sorgen – in strategischem
Einvernehmen nicht nur mit Schröder, der seine Kanzlerschaft zu verteidigen
hat, sondern auch mit „Gegenspieler“ Clement. Denn auch der
weiß: wenn Schwarz-Gelb gewinnt, sind seine Tage als
„Superminister“ gezählt.
Es ist ein Spiel über Bande, mit dem die Partei dazu gebracht werden
soll, „ihre“ Regierung mit mehr Begeisterung aktiv zu verteidigen.
Das tief Enttäuschte neue Hoffnung schöpfen lässt. Man inszeniert
den Unterschied, um die gemeinsame Sache zu sichern und voranzubringen: die
Regierungsfähigkeit der post-sozialdemokratischen SPD für den
Systemwechsel vom Sozialstaat zum Wettbewerbsstaat. Geht das Kalkül auf,
wird auch das Klima für die Entwicklung der notwendigen
außerparlamentarischer Bewegung für Sozialstaat und soziale
Gerechtigkeit wieder rauer.
Der Autor war von 1990-2000 sozialpolitischer Sprecher der grünen Landtagsfraktion in NRW und ist seither parteilos.
Posted: Mi - März 17, 2004 at 12:12 nachm.
>