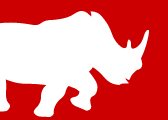
| Info zum Forum | Termine | Querbeet | Materialien | Presse | Links | Mailingliste | Kontakt | ||
| Querbeet :: aktuell | ||||||||||||||||
|
Calendar
Categories
Archives
XML/RSS Feed
|
||||||||||||||||
Fauler Kompromiß
jungeWelt 11.02.2006 / Thema / Seite 10
Sprachliche Korrekturen ändern kaum etwas am Inhalt der neoliberal inspirierten EU-Dienstleistungsrichtlinie. Sozialdemokraten auf Linie der Konservativen eingeschwenkt.
Von Sahra Wagenknecht
Es ist wohl selten eine Richtlinie so häufig öffentlich beerdigt worden wie die berüchtigte Bolkestein-Richtlinie zur Liberalisierung des EU-Dienstleistungsmarktes. Bereits im April 2005 tönte der französische Staatspräsident Jacques Chirac, »die sogenannte Bolkestein-Richtlinie gibt es nicht mehr«; sie sei unter anderem »am französischen Widerstand« gescheitert. Sekundiert wurde ihm damals von Bundeskanzler Gerhard Schröder, der von seiner anfänglichen Begeisterung für das neoliberale Brachialprojekt ebenfalls nichts mehr wissen wollte. Dies war zu der Zeit, als die Verfechter der EU-Verfassung noch hofften, in Frankreich und den Niederlanden Mehrheiten auf ihre Seite ziehen zu können.
Sprachliche Korrekturen ändern kaum etwas am Inhalt der neoliberal inspirierten EU-Dienstleistungsrichtlinie. Sozialdemokraten auf Linie der Konservativen eingeschwenkt.
Von Sahra Wagenknecht
Es ist wohl selten eine Richtlinie so häufig öffentlich beerdigt worden wie die berüchtigte Bolkestein-Richtlinie zur Liberalisierung des EU-Dienstleistungsmarktes. Bereits im April 2005 tönte der französische Staatspräsident Jacques Chirac, »die sogenannte Bolkestein-Richtlinie gibt es nicht mehr«; sie sei unter anderem »am französischen Widerstand« gescheitert. Sekundiert wurde ihm damals von Bundeskanzler Gerhard Schröder, der von seiner anfänglichen Begeisterung für das neoliberale Brachialprojekt ebenfalls nichts mehr wissen wollte. Dies war zu der Zeit, als die Verfechter der EU-Verfassung noch hofften, in Frankreich und den Niederlanden Mehrheiten auf ihre Seite ziehen zu können.
Nach den im Sinne der »Non«-Kampagne erfolgreichen
Verfassungsreferenden wurde es zunächst ruhig um das Richtlinienprojekt.
Bis nach der Sommerpause die ersten Abstimmungsergebnisse aus Ausschüssen
des EU-Parlaments an die Öffentlichkeit sickerten – nicht zuletzt
jenes des Ausschusses für Wirtschaft und Währung, der die
Europäische Kommission an Markthörigkeit und Privatisierungswut in
mancher Hinsicht noch übertraf. Die Totgeglaubte erwies sich also als
ausgesprochen lebendig.
Im November stimmte schließlich der federführende Binnenmarktausschuß des Europäischen Parlaments über die Vorlage der sozialdemokratischen Berichterstatterin, Evelyne Gebhardt, zur Dienstleistungsrichtlinie ab. Auch hier konnte die konservative Fraktion im Bündnis mit den Liberalen in allen entscheidenden Fragen ihre Vorschläge durchsetzen. Keineswegs grundlos wurde das Votum vom europäischen Industrie- und Arbeitgeberverband UNICE als positiver »Durchbruch« gefeiert. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zeigte sich hocherfreut, daß die Bolkestein-Richtlinie trotz all der massiven Kritik von Gewerkschaften, Sozialverbänden, Handwerkerorganisationen und Kleinunternehmern den Ausschuß so unbeschadet passieren konnte.
Zwar entblödeten sich einige deutsche Blätter nicht, von einer »völligen Verwässerung« der Richtlinie, ja von ihrem Ende zu fabulieren; daß Bolkesteins Projekt indes mit Siebenmeilenstiefeln der Realisierung entgegenstürmte, sprach sich aber zum Glück dann doch herum. So wurde auch die Gegenbewegung gegen die Richtlinie in den letzten Monaten europaweit wieder hörbarer und stärker. Nicht zuletzt die Mobilisierung zu den Demonstrationen am 11. und 14. Februar in Strasbourg und Berlin ist mit viel Resonanz angelaufen und läßt auf eine breite Teilnahme hoffen.
Ein »dritter Weg«?
Just zu diesem Zeitpunkt werden plötzlich wieder Totenmessen gesungen, zwar nicht so sehr auf die Dienstleistungsrichtlinie selbst, aber doch auf ihren Kernbestandteil, das Herkunftslandprinzip. »Nach langen und konsequenten Verhandlungen ist es mir gelungen, den Stein des Anstoßes – das Herkunftslandprinzip – aus der Dienstleistungsrichtlinie herauszunehmen«, verkündete eine freudestrahlende Evelyne Gebhardt am Mittwoch vor der Presse. »Ich habe mich für einen dritten Weg stark gemacht, der gleichzeitig die Öffnung der Märkte ermöglicht und dabei das europäische Sozialmodell garantiert«, preist Gebhardt den vorgeblichen Verhandlungserfolg. Auch SPD-Chef Matthias Platzeck findet, daß die Einigung das »europäische Sozialmodell« – oder das, was davon noch übrig ist – sichere. Ausnahmslos positiv zum gefundenen Kompromiß äußert sich freilich auch so mancher, der bisher als Verfechter sozialstaatlicher Prinzipien noch weniger aufgefallen ist. Der ehemalige CDU-Generalsekretär Laurenz Mayer beispielsweise teilte stellvertretend für seine gesamte Partei mit, die Union sei mit der gefundenen Lösung »gut einverstanden«. Große Koalition im Bund und in Europa zur Verteidigung von sozialen Standards und Beschäftigtenrechten?
Eine ungewohnte Vorstellung. Und eine, an die man sich auch gar nicht erst gewöhnen muß. Sieht man sich den gefeierten Kompromiß nämlich ein bißchen genauer an, wird deutlich, daß er vor allem eines ist: ein Einschwenken der Sozialdemokraten auf die Linie, die Konservative und Liberale von Beginn an vertreten haben. Das betrifft insbesondere die Haltung zum Kern der Dienstleistungsrichtlinie, dem Herkunftslandprinzip, nach dem grenzüberschreitend tätige Dienstleistungsanbieter nur noch den Regeln des Landes unterliegen sollen, in dem sie ihre Niederlassung angemeldet haben.
Die Regelungen zum Herkunftsland finden sich in Artikel 16 der Richtlinie, auf den sich von Beginn an die Auseinandersetzung konzentrierte. Bereits im Vorfeld der Abstimmung im Binnenmarktausschuß war die sozialdemokratische Berichterstatterin den Konservativen ein erhebliches Stück entgegengekommen. Statt einer generellen Ablehnung des Herkunftslandsprinzips, wie von Gewerkschaften und sozialen Organisationen immer wieder gefordert und auch von nicht wenigen Sozialdemokraten im Europäischen Parlament vertreten, enthielt ihr Antrag eine Zweiteilung: Der Zugang zur Erbringung von Diensten sollte, wie von der Kommission gewünscht, den Regeln des Herkunftslandes unterliegen; für die Ausübung der Dienstleistungstätigkeit indessen sollten die Gesetze des Bestimmungslandes gelten, des Landes also, in dem die Dienstleistung tatsächlich erbracht wird. Diese Regelung, die im übrigen exakt dem Inhalt der Bundesratsinitiative des hessischen CDU-Ministerpräsidenten Roland Koch im Bundestagswahlkampf entsprach, ist keineswegs unproblematisch, da eine klare Grenzziehung zwischen dem Zugang zur Erbringung einer Dienstleistung und der Ausübung einer Dienstleistung in der Praxis nur schwer möglich ist. Der erste Teil des sozialdemokratischen Antrags hätte daher durchaus auf eine Einführung des Herkunftslandsprinzips durch die Hintertür hinauslaufen können.
Doch selbst diese Anlehnung an konservative Positionen hatte damals nicht genügt, dem sozialdemokratischen Antrag eine Mehrheit zu verschaffen. Statt dessen wurde im Ausschuß ein Antrag von Konservativen und Liberalen angenommen, nach dem Dienstleistungserbringer künftig »ausschließlich den Bestimmungen des Mitgliedsstaats der Niederlassung«, also den Gesetzen ihres Herkunftslandes, unterliegen sollten; und zwar »in bezug auf den Zugang zu Dienstleistungstätigkeiten und deren Ausübung«, wobei letzteres »insbesondere die Anforderungen in bezug auf die Niederlassung und die Tätigkeit der Dienstleistungserbringer, das Verhalten der Dienstleistungserbringer, die Qualität oder den Inhalt der Dienstleistung sowie die Normen und Zertifizierungen« einschließt. Mehr hat auch die Kommission nie gefordert.
Die einzige ernsthafte Einschränkung, die vorgenommen wurde, betrifft das Recht zur Kontrolle der Dienstleistungstätigkeit, das dem Bestimmungsland übertragen wurde. Allerdings ist mehr als fraglich, ob letzteres eine ernsthafte Kontrolle unter solchen Bedingungen noch ausüben kann. Denn im Grunde bedeutet diese Konstruktion, das ein Mitgliedsland dafür verantwortlich wäre, die Einhaltung der Gesetze anderer Mitgliedstaaten, also im Extremfall 24 verschiedener Rechtsordnungen, für die auf seinem Territorium tätigen Unternehmen zu überprüfen.
Der Begriff des Herkunftslandes als solcher freilich tauchte bereits in der vom Binnenmarktausschuß verabschiedeten Version der Richtlinie nicht mehr auf. Die Überschrift von Artikel 16, die ursprünglich »Herkunftslandprinzip« lautete, wurde in »Freizügigkeit für Dienstleistungen« umgeändert. Wenn Evelyne Gebhardt jetzt als Erfolg verkündet, sie habe »den umstrittenen Artikel 16 (Herkunftslandprinzip) durch ›freedom to provide services‹ ersetzt«, ist ihr offenbar entfallen, daß eben diese Veränderung bereits im November von der konservativen Fraktion durchgesetzt wurde.
Schwammige Formulierungen
Auch inhaltlich ist das, was als gefeierter Kompromiß zu Artikel 16 daherkommt, so völlig neu nicht. Zwar wird jetzt nicht mehr pauschal festgelegt, daß grenzüberschreitende Unternehmen nur noch den Gesetzen des Landes unterliegen, in dem sie niedergelassen sind. Umgekehrt verzichtet der neue Text aber auch auf jede Festlegung, daß die Gesetze des Tätigkeitslandes gelten sollten. Statt dessen wird schwammig formuliert, daß die Mitgliedstaaten »den freien Zugang und die freie Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten auf ihrem Territorium sicherstellen« sollen. Die entscheidende Frage ist damit: Was heißt »freie Ausübung«? Ausübung auf Basis der Gesetze des Herkunftslandes?
Tatsächlich wird genau diese Interpretation durch die Folgebestimmungen nahegelegt. So wird im anschließenden Absatz klargestellt, daß die Mitgliedstaaten den Zugang zu oder die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit auf ihrem Territorium keinen Bestimmungen unterwerfen dürfen, die die Prinzipien der Nichtdiskriminierung, der Notwendigkeit und der Proportionalität verletzten. Hinsichtlich der »Notwendigkeit« wird ausgeführt, daß die Regelungen gerechtfertigt sein müssen »aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder öffentlichen Sicherheit oder mit Blick auf den Schutz von Gesundheit und Umwelt«. Alle Gesetze, die sich nicht zwingend mit Blick auf öffentliche Sicherheit, Gesundheit oder Umwelt rechtfertigen lassen, gelten für den ausländischen Dienstleistungserbringer also offenbar nicht, sondern da unterliegt er den Gesetzen des Landes, in dem er niedergelassen ist.
Es folgt dann noch eine ganze Liste von gesetzlichen Anforderungen, die die Mitgliedstaaten in jedem Fall abschaffen müssen: Dazu zählt erstens die Auflage, daß Dienstleistungserbringer auf ihrem Territorium eine Niederlassung errichten müssen, wenn sie ihre Dienste anbieten wollen. Ebenso untersagt wird den Mitgliedstaaten jede Einmischung in die Vertragsgestaltung, was nicht nur Verbraucherschutzrechte elementar in Frage stellt, sondern indirekt auch alle Gesetze zur Bekämpfung von Scheinselbständigkeit obsolet machen dürfte. Der Dienstleistungserbringer soll auch nicht mehr verpflichtet werden dürfen, einen Identitätsnachweis von seiten seiner zuständigen Behörden beizubringen. Schließlich soll es in Zukunft keinerlei gesetzliche Auflagen mehr geben dürfen, die Ausrüstungsgegenstände oder verwendete Materialien betreffen – eingeschränkt wiederum durch eine Klausel betreffend Gesundheits- und Arbeitsschutz. In einem abschließenden Absatz wird dann noch einmal wiederholt, daß die Mitgliedstaaten die Tätigkeit ausländischer Dienstleistungsanbieter insoweit eigenen Gesetzen unterwerfen dürfen, als diese »aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der öffentlichen Sicherheit oder der Sozialpolitik, des Verbraucherschutzes, des Umweltschutzes und der Volksgesundheit« als notwendig erachtet werden.
Das Bizarre dieses letzten Absatzes besteht darin, daß eine solche Einschränkung überhaupt nur dann Sinn macht, wenn generell eben nicht die Gesetze des Landes der Dienstleistungserbringung, sondern die des Herkunftslandes gelten. Genau in diesem Sinn einer Einschränkung des Herkunftslandprinzips war diese Passage übrigens bereits in dem erwähnten Antrag der Konservativen enthalten, der vom Binnenmarktausschuß beschlossen wurde. Damals waren auch die Sozialdemokraten noch der Meinung, daß solche Abmilderungen die desaströsen Auswirkungen des Herkunftslandprinzips keineswegs relevant verändern. Inzwischen aber hat offenbar großkoalitionäres Umdenken eingesetzt.
Herkunftslandprinzip erhalten
Daß der Kompromißtext unverändert auf das Herkunftslandprinzip setzt, bestätigte im übrigen auch der konservative österreichische Abgeordnete Othmar Karas, der selbst Mitglied des Verhandlungsteams war. Gegenüber der österreichischen Tageszeitung Der Standard betonte er, daß zwar »der Begriff Herkunftslandprinzip nicht mehr verwendet wird, aber das Grundprinzip bleibt« (Standard, 9.2.2006).
Am Ende enthält der Kompromißentwurf zu Artikel 16 dann noch ein nettes Schmankerl für Gewerkschaften und soziale Bewegungen, nämlich die Festlegung, daß die Kommission spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern einen Bericht über die Anwendung dieses Artikels 16 vorlegen soll, in dem sie zugleich die Möglichkeit von Harmonisierungen im Bereich des Dienstleistungsmarktes »erwägen« möge. Unverbindlicher geht's nimmer. Von der ursprünglichen Forderung nach Harmonisierung der Standards auf hohem Niveau ist damit nicht mehr geblieben als eine zu nichts verpflichtende Absichtserklärung für die ferne Zukunft.
Was den von der SPD gelobten Kompromiß zum Herkunftslandprinzip also vom bisherigen Richtlinienentwurf unterscheidet, ist weniger der konkrete Inhalt als die Schwammigkeit und Ausdeutbarkeit der Formulierungen. Die Konzernlobby sollte damit bestens leben können, da in letzter Instanz der Europäische Gerichtshof angerufen werden kann, um klarzustellen, was an Regelungen im Sinne von Umwelt, Gesundheit und öffentlicher Sicherheit tatsächlich als gerechtfertigt anzusehen ist beziehungsweise welche Gesetze die »freie Ausübung« von Dienstleistungstätigkeiten in unzulässiger Weise beschränken. Wie vergangene Entscheidungen zeigen, fallen Urteile aus diesem Hause äußerst selten zu Lasten der Wirtschaftsmächtigen aus.
Der Umfall der Sozialdemokraten betrifft allerdings nicht nur Artikel 16 allein. Auch im Hinblick auf den Geltungsbereich der Richtlinie, Artikel 2, haben sie sich von ihren einst verkündeten Positionen weit entfernt. So gab es bei der Abstimmung im Binnenmarktausschuß immerhin noch zwei gegensätzliche Anträge. Der von den Sozialisten eingebrachte und von der Linksfraktion und den Grünen unterstützte forderte die Ausklammerung sämtlicher Bereiche der Daseinsvorsorge – also im EU-Jargon: aller Dienste von allgemeinem und allgemeinem wirtschaftlichen Interesse – aus dem Geltungsbereich des Deregulierungsprojekts, um wenigstens in diesen Sektoren ein Mindestmaß an öffentlicher Einflußnahme zu erhalten.
Dagegen stand der Antrag von Konservativen und Liberalen, der entsprechend dem Original der Kommission die Einbeziehung der Daseinsvorsorge verlangte. Scheinbar abgeschwächt wurde der neoliberale Vorstoß durch einige Bestimmungen, die besagten, daß die Richtlinie keine Liberalisierung oder Privatisierung bisher nicht dem Wettbewerb geöffneter Sektoren bewirken solle. Angesichts dessen, daß es aber EU-weit kaum noch einen Sektor gibt, der nicht irgendwo bereits dem Wettbewerb geöffnet ist, ist diese Einschränkung kaum mehr als ein Lippenbekenntnis. Denn auch so elementare Dienste wie Bildung, Wasserversorgung oder Abfallbeseitigung sind mit dem Markteintritt privater Anbieter längst dem Wettbewerb geöffnet und würden mit der Richtlinie flächendeckend dem »freien Spiel kapitalistischer Marktkräfte« unterworfen. Bei der Abstimmung im Ausschuß fand dieser konservativ-liberale Antrag erwartungsgemäß eine Mehrheit, lediglich der Gesundheitssektor, die audiovisuellen Dienste und der Bereich des Glücksspiels wurden aus dem Geltungsbereich der Richtlinie ausgeklammert.
Lügen und Fehlinformationen
In dem neuen Kompromißtext wurde die Reihe der Ausnahmen jetzt noch durch einige wichtige weitere Bereiche ergänzt. So sollen auch Leiharbeits- und Zeitarbeitsagenturen ausgenommen werden, ferner Transportdienste, Hafendienstleistungen, soziale Dienste und Dienste von Sicherheitsagenturen. Diese Veränderungen sind nicht nebensächlich. Dennoch bleibt es eine Tatsache, daß Kernbereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge wie Wasser, Abfallentsorgung oder auch Bildung Teil des neoliberalen Machwerks bleiben und damit unter noch massiveren Deregulierungs- und Privatisierungsdruck geraten werden, als dies bereits heute der Fall ist.
Der von den Sozialdemokraten gefeierte Durchbruch ist deshalb vor allen Dingen ein Durchbruch, was die eigenen Reihen betrifft. Denen soll die Selbstaufgabe nun als großer Verhandlungssieg verkauft werden. »Aus der neoliberalen Attacke wird geradezu ein Schutzdach für das europäische Sozialmodell«, verklärt der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, Martin Schulz, sein Kungelergebnis.
Überraschend freilich kommt der von den deutschen Sozialdemokraten organisierte Kotau auf ganzer Linie nicht. Bereits die Festlegungen im Koalitionsvertrag von SPD und CDU waren so gewählt, daß sie unter Umständen sogar eine Bestätigung der Richtlinie in der vom Binnenmarktausschuß verabschiedeten Version zugelassen hätten. Das Herkunftslandprinzip wird lediglich »in der bisherigen Ausgestaltung« in Frage gestellt, ansonsten aber ein Hohelied auf die herausragende Bedeutung eines »funktionierenden Binnenmarkts« gesungen. In gleicher Intention erzählt der Dortmunder SPD-Europaabgeordnete Bernhard Rapkay seit Wochen jedem Journalisten, er sei sich sicher, daß man »eine Einigung« finde, da »die Differenzen zwischen den Lagern nicht allzu groß« seien. (FAZ, 26.1.2006). Schon das von der Kapitallobby gefeierte Ergebnis der Abstimmung im Binnenmarktausschuß bezeichnete Rapkay als »sinnvollen Kompromiß«.
Martin Schulz erläuterte vor einigen Wochen erstaunlich ehrlich die sozialdemokratische Verhandlungsstrategie: »Letztlich geht es in den Gesprächen der kommenden Wochen weniger um inhaltliche als um sprachliche Korrekturen. ... Mit den Grundzügen der Richtlinie können die Sozialdemokraten leben – zumindest in der Fassung, die der Binnenmarktausschuß im Herbst beschlossen hat.«
Es bleibt zu hoffen, daß Gewerkschaften, soziale Organisationen und alle anderen von der Richtlinie in ihrer Existenz Bedrohten sich nicht von den präsentierten Lügen und Fehlinformationen blenden lassen. Jetzt erst recht muß Widerstand geleistet werden gegen die große Koalition der Sozialabbauer und Verfechter eines entfesselten Kapitalismus in Europa. Die Richtlinie ist nicht substantiell verändert oder eingeschränkt worden. Sie ist auch mit den angeblichen Kompromissen das, was sie immer war – ein Freibrief für Sozialabbau, Lohndumping und ungehemmte Profite der Großkonzerne. Mächtige Demonstrationen gegen die Dienstleistungsrichtlinie sind deshalb dringender nötig denn je! Die Hafenarbeiter haben vorgemacht, auf welchem Wege man neoliberale Übeltaten aus den Think-tanks der Wirtschaftslobbys tatsächlich beerdigen kann. Durch Arbeitskämpfe und starke Protestbewegungen, nicht durch parlamentarische Kungelrunden.
Quelle: http://www.jungewelt.de/2006/02-11/043.php
Im November stimmte schließlich der federführende Binnenmarktausschuß des Europäischen Parlaments über die Vorlage der sozialdemokratischen Berichterstatterin, Evelyne Gebhardt, zur Dienstleistungsrichtlinie ab. Auch hier konnte die konservative Fraktion im Bündnis mit den Liberalen in allen entscheidenden Fragen ihre Vorschläge durchsetzen. Keineswegs grundlos wurde das Votum vom europäischen Industrie- und Arbeitgeberverband UNICE als positiver »Durchbruch« gefeiert. Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) zeigte sich hocherfreut, daß die Bolkestein-Richtlinie trotz all der massiven Kritik von Gewerkschaften, Sozialverbänden, Handwerkerorganisationen und Kleinunternehmern den Ausschuß so unbeschadet passieren konnte.
Zwar entblödeten sich einige deutsche Blätter nicht, von einer »völligen Verwässerung« der Richtlinie, ja von ihrem Ende zu fabulieren; daß Bolkesteins Projekt indes mit Siebenmeilenstiefeln der Realisierung entgegenstürmte, sprach sich aber zum Glück dann doch herum. So wurde auch die Gegenbewegung gegen die Richtlinie in den letzten Monaten europaweit wieder hörbarer und stärker. Nicht zuletzt die Mobilisierung zu den Demonstrationen am 11. und 14. Februar in Strasbourg und Berlin ist mit viel Resonanz angelaufen und läßt auf eine breite Teilnahme hoffen.
Ein »dritter Weg«?
Just zu diesem Zeitpunkt werden plötzlich wieder Totenmessen gesungen, zwar nicht so sehr auf die Dienstleistungsrichtlinie selbst, aber doch auf ihren Kernbestandteil, das Herkunftslandprinzip. »Nach langen und konsequenten Verhandlungen ist es mir gelungen, den Stein des Anstoßes – das Herkunftslandprinzip – aus der Dienstleistungsrichtlinie herauszunehmen«, verkündete eine freudestrahlende Evelyne Gebhardt am Mittwoch vor der Presse. »Ich habe mich für einen dritten Weg stark gemacht, der gleichzeitig die Öffnung der Märkte ermöglicht und dabei das europäische Sozialmodell garantiert«, preist Gebhardt den vorgeblichen Verhandlungserfolg. Auch SPD-Chef Matthias Platzeck findet, daß die Einigung das »europäische Sozialmodell« – oder das, was davon noch übrig ist – sichere. Ausnahmslos positiv zum gefundenen Kompromiß äußert sich freilich auch so mancher, der bisher als Verfechter sozialstaatlicher Prinzipien noch weniger aufgefallen ist. Der ehemalige CDU-Generalsekretär Laurenz Mayer beispielsweise teilte stellvertretend für seine gesamte Partei mit, die Union sei mit der gefundenen Lösung »gut einverstanden«. Große Koalition im Bund und in Europa zur Verteidigung von sozialen Standards und Beschäftigtenrechten?
Eine ungewohnte Vorstellung. Und eine, an die man sich auch gar nicht erst gewöhnen muß. Sieht man sich den gefeierten Kompromiß nämlich ein bißchen genauer an, wird deutlich, daß er vor allem eines ist: ein Einschwenken der Sozialdemokraten auf die Linie, die Konservative und Liberale von Beginn an vertreten haben. Das betrifft insbesondere die Haltung zum Kern der Dienstleistungsrichtlinie, dem Herkunftslandprinzip, nach dem grenzüberschreitend tätige Dienstleistungsanbieter nur noch den Regeln des Landes unterliegen sollen, in dem sie ihre Niederlassung angemeldet haben.
Die Regelungen zum Herkunftsland finden sich in Artikel 16 der Richtlinie, auf den sich von Beginn an die Auseinandersetzung konzentrierte. Bereits im Vorfeld der Abstimmung im Binnenmarktausschuß war die sozialdemokratische Berichterstatterin den Konservativen ein erhebliches Stück entgegengekommen. Statt einer generellen Ablehnung des Herkunftslandsprinzips, wie von Gewerkschaften und sozialen Organisationen immer wieder gefordert und auch von nicht wenigen Sozialdemokraten im Europäischen Parlament vertreten, enthielt ihr Antrag eine Zweiteilung: Der Zugang zur Erbringung von Diensten sollte, wie von der Kommission gewünscht, den Regeln des Herkunftslandes unterliegen; für die Ausübung der Dienstleistungstätigkeit indessen sollten die Gesetze des Bestimmungslandes gelten, des Landes also, in dem die Dienstleistung tatsächlich erbracht wird. Diese Regelung, die im übrigen exakt dem Inhalt der Bundesratsinitiative des hessischen CDU-Ministerpräsidenten Roland Koch im Bundestagswahlkampf entsprach, ist keineswegs unproblematisch, da eine klare Grenzziehung zwischen dem Zugang zur Erbringung einer Dienstleistung und der Ausübung einer Dienstleistung in der Praxis nur schwer möglich ist. Der erste Teil des sozialdemokratischen Antrags hätte daher durchaus auf eine Einführung des Herkunftslandsprinzips durch die Hintertür hinauslaufen können.
Doch selbst diese Anlehnung an konservative Positionen hatte damals nicht genügt, dem sozialdemokratischen Antrag eine Mehrheit zu verschaffen. Statt dessen wurde im Ausschuß ein Antrag von Konservativen und Liberalen angenommen, nach dem Dienstleistungserbringer künftig »ausschließlich den Bestimmungen des Mitgliedsstaats der Niederlassung«, also den Gesetzen ihres Herkunftslandes, unterliegen sollten; und zwar »in bezug auf den Zugang zu Dienstleistungstätigkeiten und deren Ausübung«, wobei letzteres »insbesondere die Anforderungen in bezug auf die Niederlassung und die Tätigkeit der Dienstleistungserbringer, das Verhalten der Dienstleistungserbringer, die Qualität oder den Inhalt der Dienstleistung sowie die Normen und Zertifizierungen« einschließt. Mehr hat auch die Kommission nie gefordert.
Die einzige ernsthafte Einschränkung, die vorgenommen wurde, betrifft das Recht zur Kontrolle der Dienstleistungstätigkeit, das dem Bestimmungsland übertragen wurde. Allerdings ist mehr als fraglich, ob letzteres eine ernsthafte Kontrolle unter solchen Bedingungen noch ausüben kann. Denn im Grunde bedeutet diese Konstruktion, das ein Mitgliedsland dafür verantwortlich wäre, die Einhaltung der Gesetze anderer Mitgliedstaaten, also im Extremfall 24 verschiedener Rechtsordnungen, für die auf seinem Territorium tätigen Unternehmen zu überprüfen.
Der Begriff des Herkunftslandes als solcher freilich tauchte bereits in der vom Binnenmarktausschuß verabschiedeten Version der Richtlinie nicht mehr auf. Die Überschrift von Artikel 16, die ursprünglich »Herkunftslandprinzip« lautete, wurde in »Freizügigkeit für Dienstleistungen« umgeändert. Wenn Evelyne Gebhardt jetzt als Erfolg verkündet, sie habe »den umstrittenen Artikel 16 (Herkunftslandprinzip) durch ›freedom to provide services‹ ersetzt«, ist ihr offenbar entfallen, daß eben diese Veränderung bereits im November von der konservativen Fraktion durchgesetzt wurde.
Schwammige Formulierungen
Auch inhaltlich ist das, was als gefeierter Kompromiß zu Artikel 16 daherkommt, so völlig neu nicht. Zwar wird jetzt nicht mehr pauschal festgelegt, daß grenzüberschreitende Unternehmen nur noch den Gesetzen des Landes unterliegen, in dem sie niedergelassen sind. Umgekehrt verzichtet der neue Text aber auch auf jede Festlegung, daß die Gesetze des Tätigkeitslandes gelten sollten. Statt dessen wird schwammig formuliert, daß die Mitgliedstaaten »den freien Zugang und die freie Ausübung von Dienstleistungstätigkeiten auf ihrem Territorium sicherstellen« sollen. Die entscheidende Frage ist damit: Was heißt »freie Ausübung«? Ausübung auf Basis der Gesetze des Herkunftslandes?
Tatsächlich wird genau diese Interpretation durch die Folgebestimmungen nahegelegt. So wird im anschließenden Absatz klargestellt, daß die Mitgliedstaaten den Zugang zu oder die Ausübung einer Dienstleistungstätigkeit auf ihrem Territorium keinen Bestimmungen unterwerfen dürfen, die die Prinzipien der Nichtdiskriminierung, der Notwendigkeit und der Proportionalität verletzten. Hinsichtlich der »Notwendigkeit« wird ausgeführt, daß die Regelungen gerechtfertigt sein müssen »aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder öffentlichen Sicherheit oder mit Blick auf den Schutz von Gesundheit und Umwelt«. Alle Gesetze, die sich nicht zwingend mit Blick auf öffentliche Sicherheit, Gesundheit oder Umwelt rechtfertigen lassen, gelten für den ausländischen Dienstleistungserbringer also offenbar nicht, sondern da unterliegt er den Gesetzen des Landes, in dem er niedergelassen ist.
Es folgt dann noch eine ganze Liste von gesetzlichen Anforderungen, die die Mitgliedstaaten in jedem Fall abschaffen müssen: Dazu zählt erstens die Auflage, daß Dienstleistungserbringer auf ihrem Territorium eine Niederlassung errichten müssen, wenn sie ihre Dienste anbieten wollen. Ebenso untersagt wird den Mitgliedstaaten jede Einmischung in die Vertragsgestaltung, was nicht nur Verbraucherschutzrechte elementar in Frage stellt, sondern indirekt auch alle Gesetze zur Bekämpfung von Scheinselbständigkeit obsolet machen dürfte. Der Dienstleistungserbringer soll auch nicht mehr verpflichtet werden dürfen, einen Identitätsnachweis von seiten seiner zuständigen Behörden beizubringen. Schließlich soll es in Zukunft keinerlei gesetzliche Auflagen mehr geben dürfen, die Ausrüstungsgegenstände oder verwendete Materialien betreffen – eingeschränkt wiederum durch eine Klausel betreffend Gesundheits- und Arbeitsschutz. In einem abschließenden Absatz wird dann noch einmal wiederholt, daß die Mitgliedstaaten die Tätigkeit ausländischer Dienstleistungsanbieter insoweit eigenen Gesetzen unterwerfen dürfen, als diese »aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder der öffentlichen Sicherheit oder der Sozialpolitik, des Verbraucherschutzes, des Umweltschutzes und der Volksgesundheit« als notwendig erachtet werden.
Das Bizarre dieses letzten Absatzes besteht darin, daß eine solche Einschränkung überhaupt nur dann Sinn macht, wenn generell eben nicht die Gesetze des Landes der Dienstleistungserbringung, sondern die des Herkunftslandes gelten. Genau in diesem Sinn einer Einschränkung des Herkunftslandprinzips war diese Passage übrigens bereits in dem erwähnten Antrag der Konservativen enthalten, der vom Binnenmarktausschuß beschlossen wurde. Damals waren auch die Sozialdemokraten noch der Meinung, daß solche Abmilderungen die desaströsen Auswirkungen des Herkunftslandprinzips keineswegs relevant verändern. Inzwischen aber hat offenbar großkoalitionäres Umdenken eingesetzt.
Herkunftslandprinzip erhalten
Daß der Kompromißtext unverändert auf das Herkunftslandprinzip setzt, bestätigte im übrigen auch der konservative österreichische Abgeordnete Othmar Karas, der selbst Mitglied des Verhandlungsteams war. Gegenüber der österreichischen Tageszeitung Der Standard betonte er, daß zwar »der Begriff Herkunftslandprinzip nicht mehr verwendet wird, aber das Grundprinzip bleibt« (Standard, 9.2.2006).
Am Ende enthält der Kompromißentwurf zu Artikel 16 dann noch ein nettes Schmankerl für Gewerkschaften und soziale Bewegungen, nämlich die Festlegung, daß die Kommission spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten der Richtlinie in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten und den Sozialpartnern einen Bericht über die Anwendung dieses Artikels 16 vorlegen soll, in dem sie zugleich die Möglichkeit von Harmonisierungen im Bereich des Dienstleistungsmarktes »erwägen« möge. Unverbindlicher geht's nimmer. Von der ursprünglichen Forderung nach Harmonisierung der Standards auf hohem Niveau ist damit nicht mehr geblieben als eine zu nichts verpflichtende Absichtserklärung für die ferne Zukunft.
Was den von der SPD gelobten Kompromiß zum Herkunftslandprinzip also vom bisherigen Richtlinienentwurf unterscheidet, ist weniger der konkrete Inhalt als die Schwammigkeit und Ausdeutbarkeit der Formulierungen. Die Konzernlobby sollte damit bestens leben können, da in letzter Instanz der Europäische Gerichtshof angerufen werden kann, um klarzustellen, was an Regelungen im Sinne von Umwelt, Gesundheit und öffentlicher Sicherheit tatsächlich als gerechtfertigt anzusehen ist beziehungsweise welche Gesetze die »freie Ausübung« von Dienstleistungstätigkeiten in unzulässiger Weise beschränken. Wie vergangene Entscheidungen zeigen, fallen Urteile aus diesem Hause äußerst selten zu Lasten der Wirtschaftsmächtigen aus.
Der Umfall der Sozialdemokraten betrifft allerdings nicht nur Artikel 16 allein. Auch im Hinblick auf den Geltungsbereich der Richtlinie, Artikel 2, haben sie sich von ihren einst verkündeten Positionen weit entfernt. So gab es bei der Abstimmung im Binnenmarktausschuß immerhin noch zwei gegensätzliche Anträge. Der von den Sozialisten eingebrachte und von der Linksfraktion und den Grünen unterstützte forderte die Ausklammerung sämtlicher Bereiche der Daseinsvorsorge – also im EU-Jargon: aller Dienste von allgemeinem und allgemeinem wirtschaftlichen Interesse – aus dem Geltungsbereich des Deregulierungsprojekts, um wenigstens in diesen Sektoren ein Mindestmaß an öffentlicher Einflußnahme zu erhalten.
Dagegen stand der Antrag von Konservativen und Liberalen, der entsprechend dem Original der Kommission die Einbeziehung der Daseinsvorsorge verlangte. Scheinbar abgeschwächt wurde der neoliberale Vorstoß durch einige Bestimmungen, die besagten, daß die Richtlinie keine Liberalisierung oder Privatisierung bisher nicht dem Wettbewerb geöffneter Sektoren bewirken solle. Angesichts dessen, daß es aber EU-weit kaum noch einen Sektor gibt, der nicht irgendwo bereits dem Wettbewerb geöffnet ist, ist diese Einschränkung kaum mehr als ein Lippenbekenntnis. Denn auch so elementare Dienste wie Bildung, Wasserversorgung oder Abfallbeseitigung sind mit dem Markteintritt privater Anbieter längst dem Wettbewerb geöffnet und würden mit der Richtlinie flächendeckend dem »freien Spiel kapitalistischer Marktkräfte« unterworfen. Bei der Abstimmung im Ausschuß fand dieser konservativ-liberale Antrag erwartungsgemäß eine Mehrheit, lediglich der Gesundheitssektor, die audiovisuellen Dienste und der Bereich des Glücksspiels wurden aus dem Geltungsbereich der Richtlinie ausgeklammert.
Lügen und Fehlinformationen
In dem neuen Kompromißtext wurde die Reihe der Ausnahmen jetzt noch durch einige wichtige weitere Bereiche ergänzt. So sollen auch Leiharbeits- und Zeitarbeitsagenturen ausgenommen werden, ferner Transportdienste, Hafendienstleistungen, soziale Dienste und Dienste von Sicherheitsagenturen. Diese Veränderungen sind nicht nebensächlich. Dennoch bleibt es eine Tatsache, daß Kernbereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge wie Wasser, Abfallentsorgung oder auch Bildung Teil des neoliberalen Machwerks bleiben und damit unter noch massiveren Deregulierungs- und Privatisierungsdruck geraten werden, als dies bereits heute der Fall ist.
Der von den Sozialdemokraten gefeierte Durchbruch ist deshalb vor allen Dingen ein Durchbruch, was die eigenen Reihen betrifft. Denen soll die Selbstaufgabe nun als großer Verhandlungssieg verkauft werden. »Aus der neoliberalen Attacke wird geradezu ein Schutzdach für das europäische Sozialmodell«, verklärt der Vorsitzende der sozialdemokratischen Fraktion im Europäischen Parlament, Martin Schulz, sein Kungelergebnis.
Überraschend freilich kommt der von den deutschen Sozialdemokraten organisierte Kotau auf ganzer Linie nicht. Bereits die Festlegungen im Koalitionsvertrag von SPD und CDU waren so gewählt, daß sie unter Umständen sogar eine Bestätigung der Richtlinie in der vom Binnenmarktausschuß verabschiedeten Version zugelassen hätten. Das Herkunftslandprinzip wird lediglich »in der bisherigen Ausgestaltung« in Frage gestellt, ansonsten aber ein Hohelied auf die herausragende Bedeutung eines »funktionierenden Binnenmarkts« gesungen. In gleicher Intention erzählt der Dortmunder SPD-Europaabgeordnete Bernhard Rapkay seit Wochen jedem Journalisten, er sei sich sicher, daß man »eine Einigung« finde, da »die Differenzen zwischen den Lagern nicht allzu groß« seien. (FAZ, 26.1.2006). Schon das von der Kapitallobby gefeierte Ergebnis der Abstimmung im Binnenmarktausschuß bezeichnete Rapkay als »sinnvollen Kompromiß«.
Martin Schulz erläuterte vor einigen Wochen erstaunlich ehrlich die sozialdemokratische Verhandlungsstrategie: »Letztlich geht es in den Gesprächen der kommenden Wochen weniger um inhaltliche als um sprachliche Korrekturen. ... Mit den Grundzügen der Richtlinie können die Sozialdemokraten leben – zumindest in der Fassung, die der Binnenmarktausschuß im Herbst beschlossen hat.«
Es bleibt zu hoffen, daß Gewerkschaften, soziale Organisationen und alle anderen von der Richtlinie in ihrer Existenz Bedrohten sich nicht von den präsentierten Lügen und Fehlinformationen blenden lassen. Jetzt erst recht muß Widerstand geleistet werden gegen die große Koalition der Sozialabbauer und Verfechter eines entfesselten Kapitalismus in Europa. Die Richtlinie ist nicht substantiell verändert oder eingeschränkt worden. Sie ist auch mit den angeblichen Kompromissen das, was sie immer war – ein Freibrief für Sozialabbau, Lohndumping und ungehemmte Profite der Großkonzerne. Mächtige Demonstrationen gegen die Dienstleistungsrichtlinie sind deshalb dringender nötig denn je! Die Hafenarbeiter haben vorgemacht, auf welchem Wege man neoliberale Übeltaten aus den Think-tanks der Wirtschaftslobbys tatsächlich beerdigen kann. Durch Arbeitskämpfe und starke Protestbewegungen, nicht durch parlamentarische Kungelrunden.
Quelle: http://www.jungewelt.de/2006/02-11/043.php
Posted: So - Februar 12, 2006 at 09:51 vorm.
>